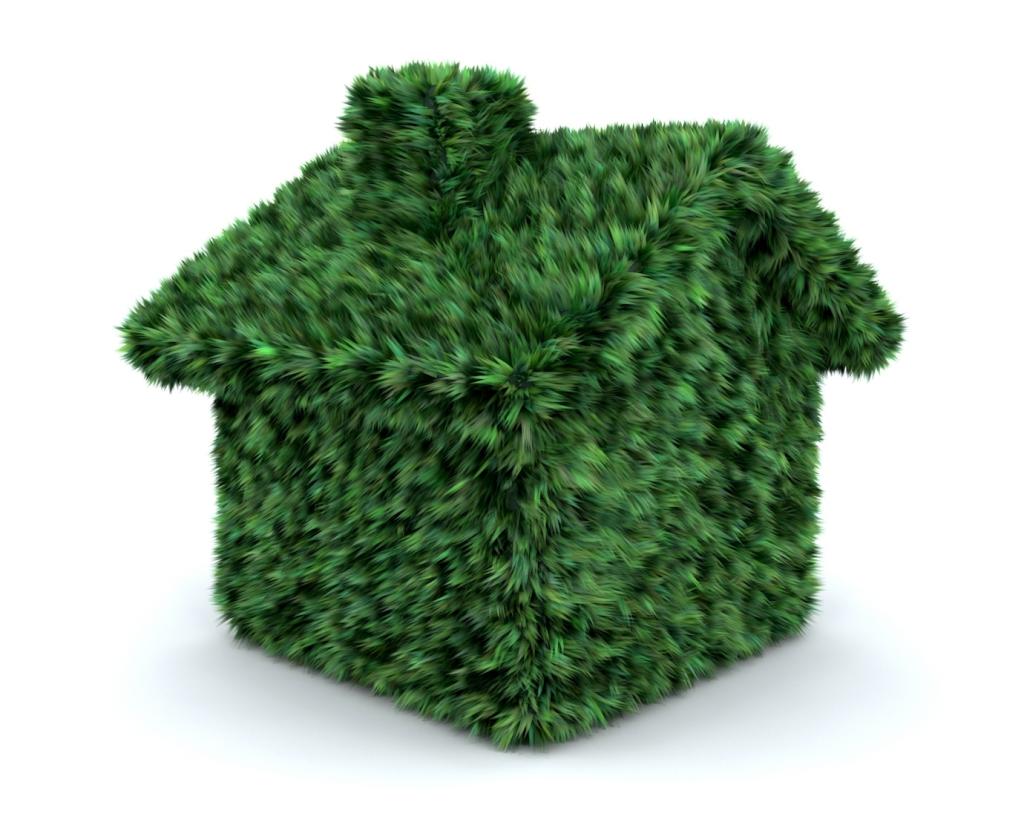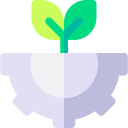This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Grüne Gebäudetechnologien in urbanen Räumen
Die Bedeutung grüner Gebäudetechnologien in städtischen Gebieten nimmt Jahr für Jahr zu. Immer mehr Metropolen setzen auf nachhaltige Lösungen, um den Energieverbrauch zu senken, CO₂-Emissionen zu reduzieren und das Wohlbefinden der Bewohnerinnen und Bewohner zu verbessern. Innovative Ansätze im Bereich der Architektur und Bautechnik erlauben es, Ressourcen zu schonen und die Natur in die Lebensräume zu integrieren. Dieser Wandel wird durch steigende Anforderungen an Klimaschutz und gesetzliche Vorgaben ebenso wie durch eine wachsende Sensibilität von Bauherren und Nutzern für Umweltfragen angetrieben. Grüne Gebäudetechnologien bieten dabei nicht nur ökologische, sondern auch ökonomische Vorteile. Sie sind ein Schlüssel für die nachhaltige Entwicklung urbaner Lebensräume.
Nachhaltige Materialien und Baustoffe


Begrünte Stadt- und Gebäudeflächen
Gründächer als ökologische Ausgleichsflächen

Digitalisierung und Smart Cities
Vernetzte Energiesysteme
Gebäudeautomation und Nutzerkomfort
Datenbasiertes Stadtmanagement
Fördermodelle und politische Rahmenbedingungen

Flächenknappheit und Verdichtung